25.12.2023
Dieser Beitrag wurde in der NZZ am 19.12.2023 veröffentlicht, siehe HIER
Zur pdf-Version des Beitrags siehe HIER
Israel vernachlässigt den arabischen Teil Jerusalems. Dem wollen der Israeli Shai Doron und der Palästinenser Wasim Elhaj entgegenhalten. Über ein Projekt, das beste Chancen hätte, zu scheitern.
Karin A. Wenger (Text), Dominic Nahr (Bilder), Jerusalem 19.12.2023

Treue Freunde: der Palästinenser Wasim Elhaj (links) und der Israeli Shai Doron
Als Shai Doron vor fünf Jahren Chef der Jerusalem Foundation wurde, sagte der Israeli seinen Mitarbeitern: Er werde die Stiftung so lange leiten, bis die Palästinenser in Ostjerusalem zwei öffentliche Schwimmbäder hätten. Der 63-Jährige erinnert sich, wie seine Kollegen die Stirn runzelten. Denn sie ahnten, dass dieses Ziel einfacher klingt, als es ist.
Doron, der beim Erzählen Energie und Optimismus versprüht, ist Schwimmer. Nervös wird er, wenn er abends um zehn Uhr noch keine Bahnen durchs Wasser gezogen hat. Einst arbeitete er im Büro des Bürgermeisters von Jerusalem. Seit 1967 habe die Verwaltung achtzehn Schwimmbäder gebaut – alle im westlichen Teil der Stadt.
Die Schwimmbecken illustrieren die Kluft, die zwischen West- und Ostjerusalem herrscht. Den östlichen Teil, den die Palästinenser als Hauptstadt eines künftigen Staates beanspruchen, besetzten israelische Truppen im Sechstagekrieg 1967. Danach begann Israel, nicht nur den Westen, sondern ganz Jerusalem zu verwalten.
Mehr als ein Drittel von der knappen Million Einwohnern sind Muslime. Die meisten haben eine Aufenthaltsbewilligung, sind aber keine Bürger.
Arabischer Teil Jerusalems jahrelang vernachlässigt
In den arabischen Ostteil Jerusalems floss während Jahrzehnten nur ein Bruchteil des Budgets der Stadtverwaltung. Im Gegensatz zum Westen sind im Osten die Strassen brüchig, es fehlt an Klassenzimmern, drei Viertel der palästinensischen Familien leben unterhalb der Armutsgrenze. Diese Kluft zu schliessen, bezeichnet Shai Doron als Mission seines Lebens. «Ich will, dass Jerusalem ein Vorzeigemodell wird für gemeinsames Leben», sagt er. Das bedeutet für ihn: gleiche Rechte und gleiche
Chancen für alle. Dabei geht es ihm auch um die Unterschiede zwischen den orthodoxen Juden und den oft besser gestellten Säkularen.
Chancen für alle. Dabei geht es ihm auch um die Unterschiede zwischen den orthodoxen Juden und den oft besser gestellten Säkularen.
Jerusalem, das Juden, Muslime und Christen verehren, halten manche für einen der kompliziertesten Orte der Welt. Obschon hier immer wieder die Gewalt eskaliert, besonders auf dem Tempelberg, findet Doron: «Andere sehen Probleme, ich sehe Lösungen.»
Zwei Jahre lang arbeitete Dorons Stiftung am Plan für das Hallenbad. Er sammelte zwanzig Millionen Dollar Spendengelder, überzeugte die Stadtverwaltung und erhielt eine Baubewilligung. Im Sommer 2022 begannen die Bagger zu graben in Ostjerusalem im Quartier Beit Hanina.
Geplant ist ein modernes Sportzentrum mit drei Schwimmbecken und einem Fitnessbereich. Sobald das Gebäude steht, wird Shai Doron den Schlüssel zum Zentrum dem 34-jährigen Wasim Elhaj in die Hand drücken. Der Palästinenser leitet das Gemeindezentrum in Beit Hanina, das seit bald dreissig Jahren Sportkurse, Weiterbildungen oder Kinderbetreuung für die Bewohner der umliegenden Quartiere organisiert.

Im Gemeindezentrum im arabischen Quartier Beit Hanina in Ostjerusalem zeugen Fotos davon, wie sich das Team
seit Jahren für die Bewohner des Quartiers einsetzt.
seit Jahren für die Bewohner des Quartiers einsetzt.
Elhaj und seine lokalen Mitarbeiter werden die volle Verantwortung für das Sportzentrum tragen. «Das war meine Bedingung, dafür habe ich gekämpft. Ich brauchte einige Zeit, um die Stadt zu überzeugen», sagt Doron. Das Sportzentrum, das eigentlich in eineinhalb Jahren eröffnen sollte, wird mindestens hundert Arbeitsplätze schaffen. So lautete der Plan.
Dann kam Samstagmorgen, der 7. Oktober. Doron beschreibt, er habe die ersten Stunden, als sich die Nachrichten über das Massaker der HamasTerroristen langsam verbreitet hätten, in einer Schockstarre erlebt. «Ich bin froh, dass wir genug Weisheit und Erfahrung hatten, um schon am Samstagnachmittag aus der Starre aufzuwachen», sagt er.
Der Telefonanruf nach dem 7. Oktober
Zusammen mit seinem Team habe er sofort begonnen, Kontakt zu Geldgebern in der ganzen Welt aufzunehmen, auch in der Schweiz. Innerhalb von wenigen Stunden richteten sie einen Notfallfonds ein. Für Israeli aus dem Süden, die ihre Häuser verlassen mussten, und ein Teil sollte auch den Bewohnern in Ostjerusalem zugutekommen. «Selbst in den dunkelsten Tagen Israels müssen wir Brücken bauen.» Es war ein kurzer Telefonanruf in den Tagen nach dem Massaker, der Wasim Elhaj tief berührte. «Wie geht es dir?», habe ihn Shai Doron am anderen Ende der Leitung gefragt. «Und was brauchst du?» Zwei Fragen, vermeintlich banal, die für den Palästinenser Elhaj ein fundamentaler Beweis der Freundschaft waren.
Mit seinen anderen jüdischen Kollegen redete er in den ersten Wochen gar nicht. «Ich fürchtete, dass mir als Muslim eine Mitschuld gegeben würde», sagt Elhaj und erzählt, wie belastend die Situation gerade sei. Schon nur Mitleid zu äussern mit den vielen Zivilisten, die im Krieg in Gaza getötet würden, sei heikel. Durch die Gesellschaft in Israel zieht sich seit dem 7. Oktober viel Angst, Wut und Misstrauen. Sowohl Juden als auch Palästinenser trauern über immense Zahlen getöteter Zivilisten in ihren Gemeinschaften.

Beit Hanina in Ostjerusalem gehört zu den besseren Quartieren in Ostjerusalem.
Doron, dessen Schwiegersohn fürs israelische Militär in Gaza kämpft, hat noch nie in seinem Leben eine so angespannte Stimmung in seiner Heimat erlebt. «Nicht einmal annähernd», sagt er gleich zwei Mal hintereinander. Familien in Ostjerusalem, die von seiner Stiftung zurzeit Notfallpakete mit Essen erhielten, seien beispielsweise besorgt, ihre Nachbarn könnten erfahren, dass sie von Israeli unterstützt würden. Bevor Doron für das Gespräch mit der NZZ an diesem Tag Anfang November ins Auto gestiegen und nach Ostjerusalem gefahren ist, hat er seinen Kollegen angerufen und gefragt: «Ist es okay, wenn ich zu dir komme?» Er wolle Elhajs Arbeit im Gemeindezentrum nicht dadurch sabotieren, dass ihn seine Mitmenschen mit einem Israeli sähen und das zu schlechtem Gerede führe. Anfeindungen wegen ihrer Arbeit kennen beide Männer.
Seit Jahrzehnten arbeiten Juden und Muslime in Jerusalem zwar oft Seite an Seite, doch nur selten tauchen sie tief in das Leben des jeweils anderen ein. Die Mehrheit auf beiden Seiten liest unterschiedliche Nachrichten, lernt gegensätzliche Versionen der gemeinsamen Geschichte und sieht nur das eigene Opfernarrativ.
Zurzeit sind die Bauarbeiten unterbrochen
Die grosse Baustelle vis-à-vis von Elhajs Büro steht zurzeit fast still, denn viele Bauarbeiter sind Palästinenser aus dem Westjordanland. Über 150 000 palästinensische Arbeiter dürfen seit der HamasAttacke nicht mehr nach Israel pendeln für die Arbeit, da sich der Staat vor Angriffen fürchtet. Dennoch ist aufgeben für die beiden Freunde keine Option. Das Hallenbad eröffne halt ein paar Monate später, sagt Doron.
Man fühlt, wie sehr es ein Herzensprojekt von ihm ist, wenn er erzählt, dass Kinder in Ostjerusalem eine Dreiviertelstunde mit dem Bus fahren müssten zu einem Schwimmbecken im westlichen Stadtteil. Dort fühlten sie sich fremd und unwillkommen. «Ich spreche nicht über ein Hobby. Sondern davon, dass jedes Kind schwimmen lernen sollte», sagt er. Überdurchschnittlich viele Palästinenser ertränken in den Sommermonaten im Meer.

Wasim Elhaj schaut über die Baustelle, wo in eineinhalb Jahren ein Schwimmbad stehen wird. Zurzeit arbeitet fast niemand, da die palästinensischen Bauarbeiter aus dem Westjordanland nicht nach Jerusalem kommen.
Doch es geht um mehr als Schwimmen. Wasim Elhaj erinnert sich, wie einer seiner Mitarbeiter bei einem Treffen mit Dorons Stiftung gesagt habe: Die einzigen Israeli, mit denen er bis dahin zu tun gehabt habe, seien Polizisten oder Soldaten an Checkpoints gewesen. Da er kaum Hebräisch spricht, tauscht er sich nicht mit Israeli aus. Bei den Treffen mit der Stiftung habe er plötzlich Menschen getroffen, die Gutes tun wollten.
«Ich bin alt und werde bald pensioniert», sagt Doron und legt seine Hand auf Elhajs Schulter. «Er ist die Zukunft.» Bevor Doron aber in Rente gehen kann, will er ein zweites Schwimmbad in Ostjerusalem bauen. Pläne dafür hat er schon.

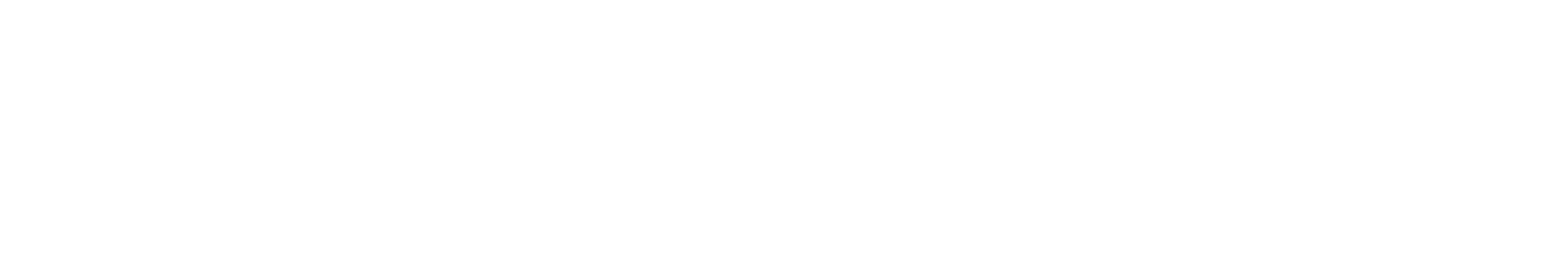
 - עיצוב אתרים
- עיצוב אתרים